Wer auch immer innerhalb des Volkswagen-Konzerns für die Software-Manipulation der Abgaswerte verantwortlich sein mag: In Wirtschaftskreisen ist man sich darüber einig, dass die Wirkung weit verheerender sein dürfte als derzeit abzusehen. Immer wieder ist auch von technischen Unzulänglichkeiten bei der Fahrzeugentwicklung die Rede. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) befasst sich schon seit Längerem mit den Themen Motorentechnik, Emissionsforschung und alternative Kraftstoffe und hat den Wissensstand aus aktuellem Anlass nun aufbereitet und öffentlich gemacht.
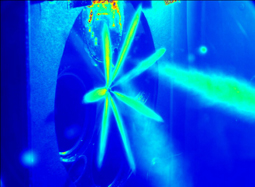 (27.10.2015) Die Diskussion um die dieselmotorischen Abgaswerte des Autokonzerns Volkswagen auf dem US-Markt hat die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Technologie der Abgasnachbehandlung gelenkt. Seit Jahren helfen wissenschaftlicher Fortschritt und technisches Know-how, bessere Motoren, Filter und Kraftstoffe zu entwickeln, die der Umwelt wirklich nutzen. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) forschen Motorentechniker und Kraftstoffdesigner schon seit Jahren für eine nachhaltigere Mobilität.
(27.10.2015) Die Diskussion um die dieselmotorischen Abgaswerte des Autokonzerns Volkswagen auf dem US-Markt hat die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Technologie der Abgasnachbehandlung gelenkt. Seit Jahren helfen wissenschaftlicher Fortschritt und technisches Know-how, bessere Motoren, Filter und Kraftstoffe zu entwickeln, die der Umwelt wirklich nutzen. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) forschen Motorentechniker und Kraftstoffdesigner schon seit Jahren für eine nachhaltigere Mobilität. | Copyright: | © Deutscher Fachverlag (DFV) |
| Quelle: | Nr. 11 - November 2015 (Oktober 2015) |
| Seiten: | 2 |
| Preis: | € 0,00 |
| Autor: | Kosta Schinarakis Martin Boeckh |
| Artikel nach Login kostenfrei anzeigen | |
| Artikel weiterempfehlen | |
| Artikel nach Login kommentieren | |
Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.
Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.
Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.